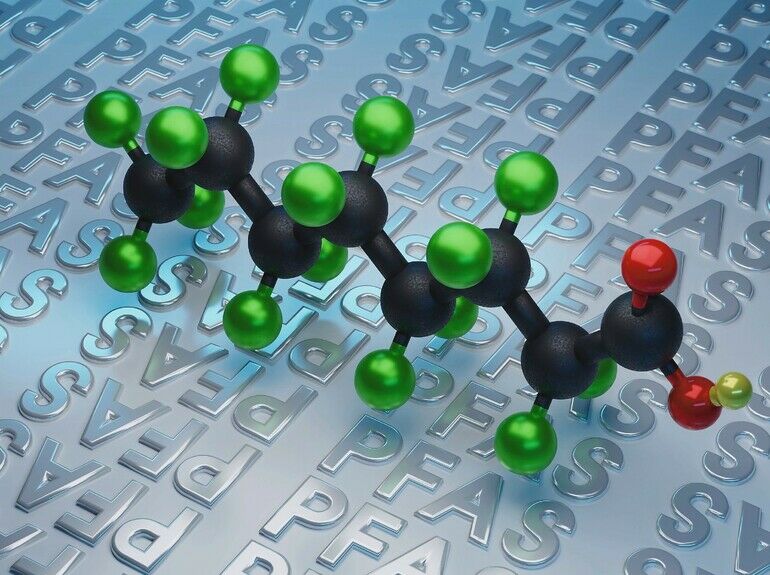Wenn Medizingeräte die gemessenen Daten zu stark auswerten, ist das für den Arzt keine Hilfe mehr, sagt Dr. Michael Reng, Chefarzt Innere Medizin in der Klinik Bogen. Wer nur noch mit errechneten Werten umgehe, verliere das Gefühl dafür, ob er es mit plausiblen Daten zu tun hat.
Herr Dr. Reng, welche Rolle hat das Patientenmonitoring heute?
Die Überwachung von Patientendaten ist in allen ihren Facetten ein explodierender Markt: Wir wollen möglichst viele Dinge ambulant erledigen, und daher muss sich die Beobachtung, also das Monitoring, bis in den häuslichen Bereich erstrecken. Erfassen lassen sich heute aus technischer Sicht sehr viele Werte. Keiner davon ist komplett verzichtbar. Was im Einzelfall gebraucht wird, ist allerdings sehr unterschiedlich.
Welche Anforderungen stellen Sie an medizinische Geräte für die Überwachung?
Ganz verallgemeinern lassen sich die Anforderungen nicht. Aber am liebsten wollen wir eine übersichtliche Darstellung der Werte, mit der sich der Verlauf beobachten lässt und die valide Daten liefert – uns also möglichst wenig Artefakte zeigt. Alles zu vereinbaren, ist aber fast nicht möglich, da jedes automatische Ausfiltern von falschen oder unsinnigen Messdaten bedeutet, dass wichtige Werte verlorengehen können. Wie gut die Angaben eines Gerätes sind, hängt also stark von den Algorithmen ab, die verwendet werden.
Wieviele Rohdaten und wieviele ausgewertete Daten möchten Sie sehen?
Man positioniert sich bei dieser Frage zwischen zwei Extremen: Auf der einen Seite könnte man alles zusammenfassen, und es gäbe nur noch einen Alarm, der besagen würde, dem Patienten geht es gut oder schlecht. Das andere Extrem ist es, sich mit den 300 oder 400 möglichen Einzelalarmen auseinanderzusetzen. Das ist eher meine Philosophie. Ich halte eine automatische Bewertung und Zusammenfassung physiologischer Werte in der Mehrzahl der Fälle für nur wenig hilfreich.
Was bringt Sie zu dieser Einschätzung?
Mehrere Überlegungen. Erstens: Jede Messung kann Fehler aufweisen. Es ist wesentlich einfacher, die klinische Plausibilität einzelner physiologischer Werte zu beurteilen als eine automatisch generierte Gesamtaussage, die sich aus einer Zusammenfassung zahlreicher Variablen errechnet. Ob so eine Gesamtwertung plausibel ist, kann man kaum hinterfragen. Zweitens: Je mehr sich ein Arzt daran gewöhnt, ausgewertete Daten zu sehen, desto mehr verliert er das Wissen um die Bedeutung der Einzelwerte, die er braucht, um im Notfall die richtige Entscheidung zu treffen.
Sind solche Trends im Alltag zu spüren?
In Prüfungen stelle ich diesen Effekt heute schon fest: Angehende Intensivmediziner können zwar mit komplex ermittelten Werten umgehen, kennen aber oftmals nicht die Einheit dieser Werte, geschweige denn die Basismessungen, aus denen der Kennwert berechnet wird. Es ist natürlich heikel, wenn zehn oder zwanzig Ergebnisse zusammengefasst werden, ein einzelner fehlbestimmter Wert dieses Ergebnis komplett verfälscht und der behandelnde Arzt die Zusammenhänge nicht erkennt.
Wo kommt es weniger auf Rohdaten an?
Wenn es um bildgebende Verfahren geht, beispielsweise um die Computertomographie. Da kann ich mit den Einzelwerten nichts anfangen. So etwas funktioniert nur über Visualisierung. Ansonsten aber möchte ich die physiologische Basis, nicht einen elektronischen Score von zweifelhaftem Nutzen. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern: Vor ein paar Jahren gab es in England Untersuchungen zu Kennwerten, die wie eine Ampel zeigen sollten, ob die weitere Behandlung des Patienten noch sinnvoll ist. Abgesehen von ethischen Bedenken, die man da haben muss, erwiesen sich die Aussagen als falsch: Es sind längst nicht alle Patienten gestorben, für die es laut Score keine Hoffnung gab. So wurde der Ansatz schnell verworfen.
Misstrauen Sie technischen Hilfsmitteln?
Geräte können mich vor einer Veränderung des klinischen Zustandes warnen. Daher beobachtet man auf der Intensivstation natürlich alle Werte, die an den Rand des zu erwarteten Bereiches gelangen. Dabei vertraue ich aber nie nur einem Gerät, sondern vergleiche die Messwerte mit der klinischen Beobachtung. Dabei frage ich mich: Stimmt die Messung? Geht es dem Patienten wirklich schlechter? Wie kommt es zu der Messwertverschiebung? Ich hinterfrage die Richtigkeit der Messwerte aber natürlich auch, wenn diese implizieren, dass es dem Patienten gerade besser geht.
Wie bewerten Sie die heute für das Patientenmonitoring verfügbaren Geräte?
Damit bin ich größtenteils zufrieden. Was wir heute nutzen, ist das Ergebnis einer Evolution über zehn oder zwanzig Jahre: Anfängliche Schwierigkeiten sind verschwunden, und wir haben zumeist vergleichbare Darstellungen, so dass man von einem Bildschirm zum nächsten wechseln kann und sich zurechtfindet. Skeptisch bin ich gegenüber Neuentwicklungen mit zusätzlichen, wissenschaftlich nicht ausreichend evaluierten Funktionalitäten. Den angeblichen Bedarf dafür sehe ich oftmals nicht.
Ließe sich dennoch etwas verbessern?
Wenn Geräte für neue, ergänzende Überwachungsmöglichkeiten eingeführt werden, sind diese in der Regel nicht zu den vorhandenen kompatibel. Wir brauchen also einen eigenen Bildschirm, um einen einzigen weiteren Wert darzustellen. Die Möglichkeit, solche Zusatzinformationen auf dem vorhandenen Bildschirm anzuzeigen, wird meiner Ansicht nach erst relativ spät angeboten, wenn sich nämlich das Gerät im Markt etabliert hat. Aus wirtschaftlicher Sicht ist das verständlich. Es wäre aber wünschenswert, die Einführungsphase zu verkürzen oder – noch besser – gleich ein integrationsfähiges System zu konzipieren.
Wo laufen technische Entwicklungen Ihrer Ansicht nach heute in die Irre?
Wir sind auf dem Weg zu einer intensiven Nutzung von Patientendaten-Managementsystemen, also PDMS. Das halte ich für eine Fehlentwicklung, denn wir speichern damit immens viele Daten, ohne mehr über den Patienten zu wissen. Ein Knopfdruck, mit dem ein Wert bestätigt wird, erfordert von der Schwester oder dem Arzt weniger Nachdenken als das eigenhändige Zusammenstellen von Daten auf dem Papier. Abgesehen davon können wir elektronische Daten bisher nicht so übersichtlich darstellen wie auf einem DINA3-Blatt. Das ginge nur, wenn wir mit riesigen Flachbildschirmen arbeiteten. Deshalb halte ich diese Entwicklung noch nicht für zweckmäßig, obwohl in die PDMS Millionen investiert wurden und werden. Es gibt aber auch positive Ansätze: Das Monitoring an sich ist in den vergangenen Jahren zuverlässiger geworden, und der Gedanke modularer Systeme, in denen sich Sensoren des einen Herstellers mit Monitoren eines anderen kombinieren lassen, setzt sich allmählich durch. Das ist sehr zu begrüßen, denn die vielen proprietären Systeme sind out.
Was erwarten Sie von Geräten in Zukunft?
Mit einiger Ironie möchte ich mir selbst widersprechen: Eine Maschine, die nur noch anzeigt, ob es dem Patienten gut oder schlecht geht, und mir dazu noch sagt, was ich tun soll. Aber im Ernst: Ich bin zwar sehr skeptisch, was das automatische Kumulieren und Beurteilen von Messwerten angeht, lasse mich aber gern von einem findigen Ingenieur und einem neuen technischen Ansatz überraschen. Ein weniger futuristisches, aber umso brennederes Anliegen ist es aber, ein ausreichendes Monitoring mit weniger Kabeln und Schläuchen – idealerweise ganz kabellos – zwischen Patient und Monitor zu ermöglichen. Das wäre traumhaft!
Dr. Birgit Oppermann birgit.oppermann@konradin.de
Weitere Informationen zur Klinik Bogen und Kontakt zu Dr. Reng www.klinik-bogen.de E-Mail: michael.reng@medicdat.de
Meinungen zum Monitoring
Mit zukünftigen Aufgaben des Patientenmonitoring befasst sich unter anderem auch Michael Imhoff von der Ruhr-Uni Bochum. Er ist Teilprojektleiter im DFG-geförderten Projekt Intelligente Analyse- und Alarmsysteme in der Intensivmedizin. Weitere Informationen und Kontakt: http://gepris.dfg.de/gepris/ (Suchfunktion „Personen“: Michael Imhoff).
Interviewpartner Dr. Reng äußert sich zu Aspekten der „Informationstechnologie in der Medizin“ in seinem 2007 erschienenen Buch. Neben Defiziten nennt er Strategien für eine Kooperation von Medizin und Informatik. MWV Medizinisch-Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, ISBN-13: 9783939069089
Ihr Stichwort
- Patientenüberwachung
- Auswertung von Daten
- Erwünschte/überflüssige neue Funktionalitäten
- Integration neuer Geräte
- Kabel- und schlauchlose Lösungen
Unsere Webinar-Empfehlung
Erfahren Sie, was sich in der Medizintechnik-Branche derzeit im Bereich 3D-Druck, Digitalisierung & Automatisierung sowie beim Thema Nachhaltigkeit tut.
Teilen: