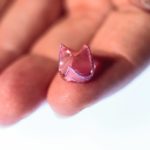E s war etwa so groß wie eine Kirsche und bestand aus echten Körperzellen – das winzige Herz, das israelische Forscher von der Universität Tel Aviv Mitte April 2019 der Öffentlichkeit vorstellten. Das Erstaunliche: Die Israelis hatten die winzigen Kammern und Blutgefäße mit einem 3D-Drucker hergestellt.
Bioprinting wurde schlagartig zum Thema
Der Medienrummel war gewaltig. Und vielfach war zu lesen, dass gedruckte Herzen schon bald Spenderorgane überflüssig machen könnten. Doch ein funktionsfähiges Herz in Originalgröße aus dem 3D-Drucker wird es so bald nicht geben. Denn das Herz aus Israel war nicht nur winzig – seine Herzmuskelzellen waren auch nicht zu einem fein abgestimmten, synchronen Schlagen zu bewegen. Aber die Idee vom lebenden Organ aus dem Drucker war schlagartig wieder Thema.
Tatsächlich stellt sich grundsätzlich die Frage, ob dereinst mit 3D-Druckern oder anderen Bioprint-Technologien Ersatzorgane hergestellt werden könnten, die Spenderorgane oder technische Lösungen wie zum Beispiel ein Kunstherz überflüssig machen. Dr. Oliver Schwarz vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart will das nicht ausschließen. Für ihn liegt die Zukunft aber eher in einer sinnvollen Kombination von Biologie und Technik.
Organ funktioniert nur zusammen mit der Umgebung
Der Leiter der Gruppe „Bionik und Medizintechnik“ kennt die Fehler, die in der Vergangenheit bei künstlichen Organen gemacht wurden: „Viele Ingenieure sahen nur die reine Funktion, hatten aber nicht verstanden, dass ein künstliches Organ perfekt auf seine Umgebung abgestimmt sein muss.“ Die ersten künstlichen Herzklappen in den 1950er-Jahren etwa bestanden aus einem Metallventil, das durch seine Bewegung reihenweise rote Blutkörperchen zertrümmerte. Die Patienten benötigten permanent Blutspenden. „Inzwischen haben wir verstanden, dass im Körper niemals harte und weiche Strukturen direkt aufeinander treffen – beides geht über Gewebe oder Beschichtungen sanft ineinander über.“
Was diese Anpassung an die Umgebung bedeutet, hat Schwarz bei der Entwicklung künstlicher Venenklappen gelernt. Venenklappen in den Beinen verhindern, dass das Blut mit der Schwerkraft in Richtung Fuß zurückfließt. Viele Menschen leiden aber unter chronischer venöser Insuffizienz der Beine. Bei ihnen bauen sich die Venenklappen ab. Bislang gibt es dafür nur eine Therapie: Stützstrümpfe, die die Venen zusammendrücken, damit die Reste der Venenklappen die Adern einigermaßen verschließen.
Beim künstlichen Organ zählt jede Kleinigkeit
Es sei erstaunlich, dass es bislang keine wirkliche Alternative gebe, wenn man bedenke, dass sehr viele Menschen von diesem Venenleiden betroffen seien, sagt Oliver Schwarz. Künstliche Venenklappen wären für viele Tausend Menschen eine Option. „Schaut man sich eine Venenklappe genauer an, dann versteht man, dass jede Kleinigkeit, jedes Merkmal eine Funktion hat – und das muss man beim künstlichen Organ berücksichtigen.“
So ist die Segelfläche einer Venenklappe nicht überall gleich dick, sondern variiert zwischen 50 und 200 µm Dicke. Einfach, damit sie sich im Blutgefäß der Beine weit genug öffnen und wieder fest verschließen kann. Hinzu kommt eine spezielle Geometrie. Das IPA-Team hat diese Prinzipien aus der Natur technisch umgesetzt. Es hat zusammen mit mehreren Unternehmen und der RWTH Aachen eine Dosier-Kinematik entwickelt, die künstliche Venenklappen aus verschiedenen dehnbaren Sorten von Polycarbonaturethan (PCU) Schicht für Schicht aufbaut.
Damit die künstliche Venenklappe vom Immunsystem nicht als fremd erkannt wird, haben die Experten sie zudem mit einer künstlichen Glykokalyx versehen, einer Schicht aus Proteinen und Polysacchariden, mit der auch Körperzellen die Außenfläche ihrer Zellmembranen beschichten. Die Kooperationspartner von der RWTH Aachen arbeiten jetzt daran, auf dem Polymer echte Körperzellen wachsen zu lassen, damit die Venenklappen künftig perfekt mit dem Körper verschmelzen.
Biologisch-technische Hybridorgane für die Zukunft
Die vom IPA zusammen mit den Partnern entwickelte Fertigungstechnik nach bionischen Prinzipien lässt sich auch auf andere Implantate wie etwa Herzklappen oder Bandscheiben übertragen. Schwarz sieht das als ersten Schritt zu biologisch-technischen Hybridorganen der Zukunft.
Auch Dr.-Ing. René von Metzen ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Organersatzes in der Verschmelzung von Biologie und Technik liegt. „Die Frage des entweder oder stellt sich für mich nicht“, sagt der Leiter des Bereichs Biomedizin und Materialwissenschaften am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) der Uni Tübingen. „Viele Organe sind so komplex, dass es selbst in Jahrzehnten nicht gelingen wird, diese exakt nachzubauen.“ In vielen Fällen habe man bis heute noch gar nicht verstanden, wie die Organe eigentlich arbeiten, beziehungsweise wie ihre Steuerung über das Nervensystem funktioniert.
Statt den Darm zu ersetzem sollen ihn Impulse steuern
Ein Beispiel sei der Darm, dessen Bewegung durch Nervenimpulse gesteuert wird. „Wir haben keine Vorstellung davon, welche Nervensignale im Detail die Bewegung steuern – wie Nervenimpulse und Bewegung korreliert sind.“ Genau diese Korrelation ist bei manchen Darmerkrankungen fehlerhaft, sodass es zu Verdauungsstörungen kommt. Statt einen künstlichen Darm zu entwickeln, geht das Team um René von Metzen einen anderen Weg: Sie wollen mit Elektroden den Nerven-Funkverkehr zwischen Gehirn und Darm abhören und mithilfe von Algorithmen die entscheidenden Steuersignale extrahieren.
„Hierbei werden wir definitiv an physikalische Grenzen stoßen“, gibt René von Metzen zu. „Über die Nervenbahnen fließen so viele elektrische Signale, dass es uns kaum gelingen wird, jedes Detail zu messen, um anschließend die Steuersignale exakt nachzuahmen.“ Er sieht aber noch eine andere Lösung, die an die Behandlung von Parkinson-Patienten mit Hirnschrittmachern erinnert. Bei diesem Verfahren der „Tiefenstimulation“, regt man das Hirn mit elektrischen Impulsen an, um das Parkinson-Zittern zu dämpfen. Man hat also eigene Frequenzmuster gefunden, die eine Wirkung zeigen. „Entsprechend wollen wir die Bewegung des Darms durch elektrische Signale anregen, die zwar nicht den ursprünglichen Nervenimpulsen entsprechen, aber dennoch eine Wirkung haben.“
Bioelektronische Medizin: Alternative zum Organersatz
Bioelektronische Medizin heißt diese junge Disziplin, in der neben René von Metzen inzwischen viele Experten aktiv sind. Nach von Metzens Ansicht bietet sich das künftig auch bei der Bauchspeicheldrüse an. Dieses Organ spielt im Blutzuckerstoffwechsel des Menschen die Hauptrolle: Es misst permanent die Zuckerkonzentration im Blut und regelt die Ausschüttung des Hormons Insulin. Dieses regt Körperzellen dazu an, Zucker aus der Umgebung aufzunehmen. Die Bauchspeicheldrüse hält also einen fein gesteuerten Regelkreis aufrecht. Ist dieser gestört, werden die Menschen zuckerkrank. Seit einigen Jahren arbeiten Experten weltweit an künstlichen Bauchspeicheldrüsen. Viele Konzepte sehen vor, einen Sensor zu implantieren, der den Zuckergehalt überwacht und bei Bedarf einer Pumpe den Befehl gibt, Insulin auszugeben. In der intakten Bauchspeicheldrüse messen die so genannten Beta-Zellen den Zuckergehalt. René von Metzen sieht in ihnen natürliche Sensoren, „die so leistungsfähig sind, dass sie ein Leben lang messen, ohne jemals kaputt zu gehen oder gewartet zu werden.“ Kein technisches System reiche an sie heran.
Statt eine defekte Bauchspeicheldrüse durch einen Apparat zu ersetzen, könne man versuchen, eine Zuckerkrankheit künftig bioelektronisch zu bekämpfen – indem man die Bauchspeicheldrüse wie den Darm mit elektrischen Impulsen bespielt. „Noch aber stehen wir ganz am Anfang“, sagt er. „Wir müssen Methoden finden, um den Informationsfluss zwischen Organen und Nervensystem auslesen zu können.“ Insofern ist die bioelektronische Medizin für ihn nicht der Weisheit letzter Schluss. „Alles hat seine Vorzüge: künstliche Organe, biologischer Organersatz oder eben auch die Biomedizin“, sagt er.
Beim Cochlea-Implantat hat Technik sich bewährt
Cochlea-Implantate etwa seien ein rein technisches System, das sich bewährt habe. Mit Cochlea-Implantaten wird Schwerhörigkeit bei jenen Menschen behandelt, bei denen die Hörschnecke, die Cochlea, defekt ist. In der Hörschnecke werden die durch Schallwellen ausgelösten Druckschwankungen in elektrische Impulse gewandelt, die dann in den Hörnerv eingespeist werden.
Beim Cochlea-Implantat führt man eine feine Elektrode in die Schnecke ein, die diese, je nach Tonhöhe, an unterschiedlichen Stellen reizt. Das Mikrofon, das die Geräusche empfängt, sitzt wie auch die Batterie außen am Kopf. Der elektrische Impulsgeber wird in den Schädelknochen implantiert. So ein Cochlea-Implantat verfügt über rund ein Dutzend Kanäle, über die verschiedene Tonhöhen in die Cochlea eingespielt werden. Das reicht für ein passables Hören. Dass Cochlea-Implantate so erfolgreich sind, hat noch einen Grund: Im Innenohr gibt es praktisch keine Immunreaktion. Fremdkörper können ohne weiteres implantiert werden.
Solche Vorteile gibt es bei einem anderen künstlichen Organersatz, an dem schon lange gearbeitet wird, nicht. Beispiel Retina-Implantat: Rund 20 Jahre lang hatten deutsche Forscher an diesem Gerät gearbeitet, das die geschädigte Netzhaut im Auge ersetzen sollte. Das Implantat sollte vor allem jenen Menschen helfen, die von der Retinitis pigmentosa betroffen sind – einer Krankheit, bei der der Körper die Netzhaut selbst zerstört. Das Implantat sollte wie ein lichtempfindlicher Fotochip in einer Kamera vor die geschädigte Netzhaut gesetzt und mit dem Sehnerv verknüpft werden.
Retina Implant: Nach Jahren kam das wirtschaftliche Aus
Vor Jahren hatte sich in Reutlingen die Retina-Implant AG gegründet, die das Implantat zur Produktreife bringen sollte. Doch im März 2019 entschieden die Aktionäre, die Gesellschaft aufzulösen. Obwohl die Fortschritte vielversprechend waren, Patienten erste Chips implantiert wurden und sie grob-gepixelte Bilder erkennen konnten. Doch letztlich waren die Hürden zu hoch: Während beim Cochlea-Implantat wenige Kanäle für ein Hörerlebnis ausreichen, müssen für ein ansprechendes Bild viele Pixel nebeneinander in den Sehnerv eingespielt werden. Für René von Metzen ist der Ansatz trotzdem vielversprechend: „Technisch hätte man das weiter entwickeln können. Die Entscheidung zur Auflösung der AG hatte sicher auch wirtschaftliche Gründe.“
Die Geschichte des Retina-Implantats zeigt, wie lange es dauern kann, technischen Ersatz für ein Organ zu entwickeln. Ein weiteres Beispiel sind Kunstherzen. Die so genannten Ventrikulären Unterstützungssysteme – kurz VAD für Ventricular assist device – unterstützen nur eine Herzkammer und sind damit kein ganzheitlicher Organersatz. Vollständige Kunstherzen wiederum werden von außen über Schläuche und einen Kompressor betrieben, ein lautes Gerät, das man auf einem Wägelchen mit sich führen muss. Auch wenn das keine Dauerlösung ist, hilft es Menschen, die von einer irreparablen Schädigung betroffen sind und auf ein Spenderherz warten.
Reinheart soll helfen, bis es biotechnische Herzen gibt
Eine Alternative entwickelt seit mehreren Jahren die Reinheart TAH GmbH, ein Spin-off der RWTH Aachen. Ihr künstliches Herz pumpt Blut mithilfe von Membranen, die von einem verschleißfreien Linearmotor bewegt werden. Ähnlich wie bei einem Lautsprecher wird die Bewegung über Magnetspulen erzeugt. Ein externer Kompressor ist nicht nötig. Das System soll künftig fünf bis acht Jahre lang arbeiten – ganz ohne Wartung. Eine weitere Besonderheit: Das Reinheart-System soll drahtlos von außen mit Strom versorgt werden, über eine Induktionsspule. Der Patient muss also nur einen schmalen Batteriegürtel tragen. „Reinheart wird vielen Patienten, die heute auf das Kunstherz mit Kompressor angewiesen sind, den Alltag wesentlich erleichtern“, sagt Heiko De Ben, technischer Direktor beim Unternehmen Reinheart. „Nicht zuletzt, weil es für viele stigmatisierend ist, ein Kompressor-Gerät in der Öffentlichkeit zu nutzen.“
Inzwischen sind alle technischen Komponenten entwickelt. Bis zur klinischen Studie aber sind noch Tests nötig. Bis die Experten das Herz erstmals einem Menschen einpflanzen können, werden noch mindestens vier Jahre vergehen.
Kunstherz muss ein komplexes Organ nachbilden
Für Heiko De Ben ist die Entwicklung eines Herzens höchst anspruchsvoll. „Das Herz ist ja kein simpler Ballon, sondern eine komplex gebaute hydraulische Pumpe.“ Es bestehe nicht nur aus Muskeln, sondern aus verschiedenen Geweben. Viele Fasern durchziehen das Organ, die den Blutfluss optimieren. „Natürlich wäre es großartig, wenn man ein komplettes Herz biotechnisch herstellen könnte – aber bis dahin werden noch mindestens 20 Jahre vergehen. In dieser Zeit kann das ‚Reinheart‘ gute Dienste leisten.“
Ein Ersatzherz, das es mit einem echten aufnehmen könnte, fehlt bislang also. Und ein Herz aus dem 3D-Drucker ist bis auf weiteres nicht in Sicht. „Man wird sich einem Organersatz aus lebenden Zellen in den kommenden Jahren daher langsam annähern“, ist Prof. Dr. Thomas Scheibel, Leiter des Lehrstuhls für Biomaterialien an der Universität Bayreuth, überzeugt. Zunächst werde man versuchen, kleinere Defekte am Herzen zu reparieren, etwa Herzmuskelzellen, die durch einen Infarkt abgestorben sind. „Der nächste Schritt wäre der Austausch von Teilen eines Organs.“ Ein vollständiges Organ mit allen Funktionen aber werde noch viele Jahre auf sich warten lassen.
Thomas Scheibel ist Experte für Materialien aus Spinnenseide, die er über sein Unternehmen Amsilk GmbH mit Sitz in Planegg an die Kosmetik- und Textilindustrie verkauft. An der Universität Bayreuth entwickelt er medizinische Lösungen.
Spinnenseide fürs Herz: Ein neuer Ansatz
Spinnenseide ist extrem strapazierfähig und löst keine Immunreaktion aus. In modifizierter Form kann sie für Medizinprodukte genutzt werden. So lässt Scheibels Team aktuell Nervenzellen an einer Schiene aus Spinnenseide entlangwachsen. Und natürlich arbeitet Scheibel auch am großen Thema „Herz“. Es ist bereits gelungen, die Seide so zu modifizieren, dass darauf Herzmuskelzellen wachsen. Das ist etwas Besonderes, denn beim lebenden Herzen funktioniert das nicht. Stirbt ein Teil des Muskels durch einen Infarkt, bildet sich dort funktionsloses Bindegewebe, denn Herzmuskelzellen sind nicht in der Lage sich auszubreiten. Doch auf der Spinnenseide funktioniert das.
Scheibel möchte nun abgestorbene Bereiche des Herzmuskels aus einem Seidengerüst nachformen und dieses Implantat mit dem Herzen verschmelzen. Das wäre ein erster Schritt zur Herzreparatur. Die aktuelle Arbeit in seinem Labor lässt hoffen: Seit mehr als drei Monaten wachsen auf einem größeren Seidengerüst Herzmuskelzellen. Und die können sogar etwas, das das gedruckte Mini-Herz aus Tel Aviv nicht vermochte: synchron schlagen.
Weitere Informationen
Über Oliver Schwarz und den
Bereich Bionik und Medizintechnik am Fraunhofer IPA:
Über Dr.-Ing. René von Metzen und seine Arbeiten am NMI:
Über das RWTH-Aachen-Spin-off Reinheart TAH:
Über Prof. Scheibel und die Bayreuther Arbeiten zur Spinnenseide:
https:// fiberlab.de
agen.
Transparent gemachte Organe als Vorlage für Bioprinting
https://medizin-und-technik.industrie.de/3d-druck/transparente-organe-als-vorlage-fuer-bioprinting/
Medizintechnik hilft, Organe vor der Transplantation zu verbessern
Perfusionsmaschine: Organ vor der Transplantation länger am Leben erhalten