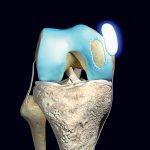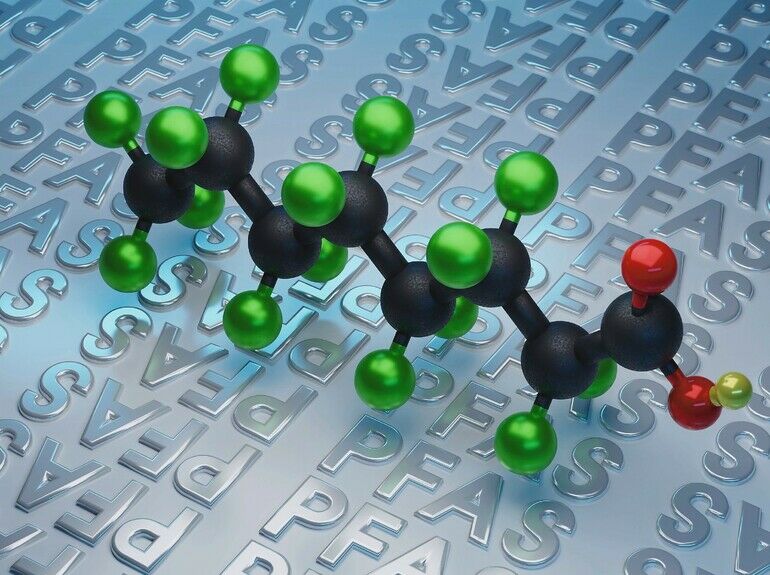Endoprothesen für das Kniegelenk werden in Zukunft stärker gefragt sein. Neben rein technischen Lösungen entsteht hier langsam ein Einsatzfeld für Tissue Engineering. Aber auch klassische Prothesen verdienen die Aufmerksamkeit der Entwickler: Jüngere Patienten brauchen stabilere und haltbarere Lösungen.
Wächst mein neues Kniegelenk im Labor, oder kommt es auch weiterhin aus der Werkzeugmaschine? Das Foto eines menschlichen Ohres auf dem Rücken einer Maus weckte vor ein paar Jahren immense Erwartungen wie auch Befürchtungen, was Forscher mit dem Züchten menschlicher Zellen, dem so genannten Tissue Engineering, alles erreichen könnten.
„Zunächst war tatsächlich die Rede davon, Organe im Labor wachsen zu lassen“, sagt Dr. Ralf Pörtner, Leiter der Abteilung Zellbiologie in der Forschungsgruppe Tissue Engineering an der TU Hamburg. Das sei so zwar nicht gelungen. Aber auf dem Weg dahin hätten Wissenschaftler gelernt, etwas weniger anspruchsvolle Ziele zu erreichen. „Knorpelmasse beispielsweise lässt sich heute außerhalb des menschlichen Körpers erzeugen.“ Solches Material wird schon eingesetzt, um Defekte im Kniegelenk zu versorgen, und die Resultate sind nach Auskunft beteiligter Unternehmen vielversprechend.
Mit dem Fortschritt auf diesem Gebiet erwächst den Herstellern von Implantaten aus Metall, Keramik und Kunststoff, die Gelenke wie Hüfte oder Knie ersetzen sollen, eine potenzielle Konkurrenz. Mittelfristig müssen sie sich trotz solcher Entwicklungen aber nicht um ihren Markt sorgen. Von kompletten Gelenken, die auf dem Weg des Tissue Engineering erzeugt werden, ist nämlich noch lange nicht die Rede.
„Knorpelstücke von der Größe einer Zehn-Cent-Münze sind schon ein Erfolg“, sagt Dr. Pörtner. Defekte am Knie sind daher ein realistisches Einsatzfeld, von künstlichen Hüften aus biologischem Material könne man aber nur träumen. Für die kommenden zehn oder fünfzehn Jahre sei nicht zu erwarten, dass das Tissue Engineering den Markt für Endoprothesen spürbar verändere.
Lebensdauer und Verträglichkeit der Implantate sollen verbessert werden
Dennoch wird bei den klassischen Prothesen nicht einfach alles bleiben wie gewohnt: Denn die Grenzen dessen, was sie zur Behandlung von Gelenkschäden beitragen können, sollen nach dem Willen der Ärzte ein wenig verschoben werden. Rund 380 Varianten von Hüftprothesen verschiedener Anbieter sind heute auf dem Markt und unterscheiden sich unter anderem in der Formgebung und in der Materialpaarung. Damit lassen sich laut Prof. Michael M. Morlock, Direktor des Zentrums für Biomechanik an der TU Hamburg-Harburg und Experte in Sachen Endoprothesen, „ältere Patienten sehr gut versorgen“. Allen verfügbaren Prothesen gemeinsam aber ist, dass das schwedische Hüftregister als durchschnittliche Standzeit 15 Jahre angibt. „Für einen Vierzigjährigen ist das keine wirkliche Perspektive“, sagt Morlock. Und so sind Verbesserungen an den Implantaten vor allem für die wachsende Zahl von Menschen wichtig, die nicht erst als Senioren eine künstliche Hüfte bekommen. Sie stellen höhere Anforderungen an Haltbarkeit und Belastbarkeit.
Wenn Implantate auch für Jüngere in Frage kommen, wird die Zahl der Eingriffe nach Ansicht von Experten weiter steigen. Schon heute begeben sich jedes Jahr allein in Deutschland rund 150 000 Patienten in die Klinik, weil sie eine künstliche Hüfte brauchen. Weitere 10 000 Menschen durchlaufen diese Prozedur schon zum zweiten Mal, weil ihr Körper das „Ersatzteil“ nach gut einem Jahrzehnt abstößt. „Warum das Gewebe so lange Zeit mit dem Fremdkörper klarkommt und dann plötzlich reagiert, ist immer noch nicht klar“, sagt Prof. Morlock. Partikel, die sich an den Reibflächen von Gelenkkopf und Pfanne lösen, könnten für die Reaktion des Körpers verantwortlich sein.
Daher suchen Ingenieure heute nach Materialien, die so gut wie keinen Abrieb hervorrufen oder nur sehr kleine Partikel freisetzen. Ob tatsächlich der Abrieb die Lebensdauer der Prothesen begrenzt, wird sich aber erst beweisen lassen, wenn es Prothesen aus abriebarmen Werkstoffen gibt. Interdisziplinäre Forscherteams aus Ingenieuren, Ärzten und Naturwissenschaftlern arbeiten derzeit beispielsweise im Sonderforschungsbereich (SFB) 599 Biomedizintechnik an der Universität Hannover zusammen und loten aus, welche Möglichkeiten der Werkstoff Keramik bietet. Dessen Oberfläche wollen sie mit nanotechnologischen Beschichtungen verändern, um das Optimum an Verträglichkeit und Stabilität aus der Kombination von Werkstoffen, Fertigungsverfahren und Beschichtungen herauszuholen. Aus dem gleichen Grund testen Forscher am Fraunhofer Center for Coatings and Laser Applications an der Michigan State University Schichten aus amorphem Kohlenstoff, die sie mit der Plasmaquelle LaserArco aufbringen. Diese Technik soll sich ohne Probleme in einen industriellen Produktionsablauf integrieren lassen, und erste Hüftgelenksimplantate werden derzeit im Simulator getestet.
Neben dem Abrieb interessieren sich Wissenschaftler auch für einen weiteren Faktor, der die Haltbarkeit der Prothesen beeinflusst: Auch von der Art der Fixierung im Körper hängt es ab, wieviel Zeit dem Patienten bis zur nächsten Operation bleibt. Ein gängiges Verfahren ist, das Implantat mit Knochenzement – einer Art Plexiglas, das sofort härtet und belastet werden kann – zu fixieren. Dieses aber wird nach spätestens 20 bis 25 Jahren brüchig. „Bessere Chancen bieten in dieser Hinsicht Endoprothesen, deren poröse Struktur und raue Oberfläche das Einwachsen der Knochenzellen ermöglichen“, sagt Morlock. Zwar müsse der Patient hierfür drei bis sechs Monate ruhen, könne dann aber auf eine längere Haltbarkeit seiner künstlichen Hüfte hoffen.
Größere Entwicklungsschübe erwartet der Hamburger Experte noch auf dem Gebiet der Knieprothesen – verbunden auch mit einem wachsenden Markt. Rund 80 000 Operationen am Knie nehmen Ärzte jährlich bei uns schon vor. „Die Zahl der Übergewichtigen steigt, und das Beispiel Amerika zeigt, dass in absehbarer Zeit wohl auch in Deutschland mehr Operationen am Kniegelenk durchgeführt werden als an der Hüfte.“ Dass in Zukunft auch das Tissue Engineering bei Behandlungen am Knie eine Rolle spielt, hält Morlock durchaus für möglich. „Da wir damit aber erst in etwa zehn Jahren rechnen können, müssen wir die Zeit bis dahin mit technischen Verbesserungen überbrücken.“
Endoprothesen für das Knie seien allerdings erheblich anspruchsvoller als Implantate für das Hüftgelenk. „Während in der Hüfte nur Rollbewegungen auftreten, gibt es im Knie eine Mischung aus Rollen und Gleiten zwischen einem Zylinder und einer glatten Fläche“, erläutert Morlock, „und die Bänder müssen exakt die richtige Spannung haben, damit das System funktioniert.“
Verbesserungspotenzial steckt auch in Navigationssystemen für den OP
Diesen Zustand mit künstlichen Komponenten zu erreichen, die heute vorwiegend aus Polyethylen und Stahllegierungen gefertigt werden, sei sehr kompliziert. Um die Endoprothesen bei der Operation richtig auszurichten, seien beispielsweise Computerunterstützung und ein Navigationssystem wichtig, das dem Arzt genaue Informationen über Ausrichtung und Position der Knochen des Patienten liefert, der vor ihm auf dem OP-Tisch liegt. „Auch hier sehe ich noch Verbesserungspotenzial“, sagt der Hamburger. Eine Abweichung von weniger als einem Grad beim Einsetzen eines Implantates wäre wünschenswert – und das sei heute selbst mit Navigationssystem nicht zu erreichen.
Einen vielversprechenden Ansatz für Verbesserungen sieht Tilman Fabian, Geschäftsführer des Sonderforschungsbereiches Biomedizintechnik, auch in der Kombination von Biologie und Technik. Beschichtungen mit Hydroxylapathit, das der Knochensubstanz ähnelt, sind heute schon auf dem Markt. Die Hannoveraner Forscher beschichten Titan und andere Werkstoffe mit Kombinationen von Polymeren und Eiweißen. Worauf lebende Zellen am besten reagieren, testen die Zellbiologen derzeit im Reagenzglas. „Hier betreiben wir noch echte Grundlagenforschung“, sagt Fabian, der wie seine Kollegen damit rechnet, dass frühestens in zehn Jahren mit Bio-Molekülen beschichtete oder von menschlichen Zellen bewachsene Metallteile auf den Markt kommen, die sich einen Anteil von 10 bis 20 % erobern könnten.
„Man darf bei diesen Überlegungen allerdings den Kostenfaktor nicht vergessen“, schränkt der Hannoveraner ein. Selbst wenn verbesserte Implantate hergestellt werden können, würden die Kassen diese Leistung wohl nicht für alle Patienten übernehmen – was wiederum die Verbreitung beeinflusse.
Dass das Tissue Engineering selbst in ferner Zukunft die klassischen Implantate komplett verdrängt, hält Fabian für unwahrscheinlich. Neben den Kosten, die für das Züchten eines Knorpelstückes aus körpereigenen Zellen anfallen, brauche dieses Verfahren mehr Zeit, als bei Notoperationen nach Unfällen oder akuten Problemen an Hüfte und Knie zur Verfügung stehe. Mehr als ein paar Prozent des Implantate-Marktes in den Industrienationen sieht er für diese Lösungen nicht. „Daher lohnt sich für einen global ausgerichteten Hersteller von Medizintechnik-Produkten auf jeden Fall die Weiterentwicklung der Standard-Implantate“, sagt Fabian.
Für einige Ingenieure könnten Gelenk-Ersatzteile aus dem Labor aber auch als Arbeits- feld interessant werden: Besonders stabiler Knorpel nämlich entsteht nach Auskunft des Hamburger Zellbiologen Dr. Pörtner nur unter Belastung. Daher simulieren in den Forschungslabors Sondermaschinen die Bedingungen, die beim Gehen, beim Sprung von der Mauer oder im Fußballspiel auftreten. Sollte der Bedarf an Knorpelmaterial, das für Knieoperationen oder auch für Medikamententests gebraucht wird, steigen, ginge damit ein Bedarf für standardisierte Simulations- und Prüfmaschinen einher.
Dr. Birgit Oppermann birgit.oppermann@konradin.de
Knorpel fürs Knie
Um kleinere Defekte am Knie mit Knorpelmaterial zu behandeln, hat die Esslinger Arthro Kinetics plc den Therapieansatz Cartilage Regeneration System (CaReS) entwickelt.
Das Verfahren basiert auf der Autologen Chondrozyten Transplantation (ACT): Per Arthroskopie, also im Rahmen einer Kniespiegelung, entnimmt der Arzt Knorpelzellen aus dem beschädigten Gelenk. Diese werden im Labor kultiviert und bei einem zweiten Eingriff als Transplantat an die defekte Stelle im Knie gebracht.
Im Unterschied zu anderen Formen des Knorpelersatzes bringen die Esslinger die Zellen direkt nach Entnahme in eine flüssige Matrix aus Kollagen ein – das spätere Transplantat. Bei Zimmertemperatur geliert die Matrix innerhalb von 20 min. Die dreidimensionale Struktur dieser Matrix entspricht der ursprünglichen biologischen Zellumgebung. So müssen die Zellen hier nur 10 bis 14 Tage wachsen, bevor die Transplantation einer definierten und homogenen Menge an Zellen stattfinden kann – bisher musste der Patient vier bis sechs Wochen auf den Knorpelersatz warten.
Marktchance: Abbaubare Magnesium-Implantate

Während Endoprothesen für Knie oder Hüfte möglichst lange im Körper bleiben sollen, setzen Ärzte auch Metallteile ein, die nach einigen Monaten überflüssig sind. Dazu gehören beispielsweise Nägel, die das Zusammenwachsen gebrochener Arm- oder Beinknochen erleichtern.
Teile aus Magnesiumlegierungen haben nach Ansicht von Tilman Fabian, Geschäftsführer des SFB Biomedizintechnik an der Uni Hannover, für solche Anwendungen besonderen Charme: Im Körper kommt Magnesium natürlicherweise vor und kann sogar abgebaut werden. Je nach Legierung braucht das Gewebe dafür unterschiedlich lange, wie Tests der Hannoveraner gezeigt haben. Somit ließe sich über die Materialauswahl die Verweildauer einer Knochenschraube steuern.
Nahtmaterial oder kleine Implantate aus dem Kunststoff Poly-L-Lactid, die sich im Körper auflösen, werden bereits seit 15 Jahren im Klinikalltag eingesetzt. Für einen stark belasteten Knochen lasse sich dieser Kunststoff aber nicht verwenden. Aus Sicht der Krankenkassen wären daher stabile, aber abbaubare Implantate auf der Basis von Magnesium eine gute Sache. Da sie nicht entfernt werden müssen, entfällt der mit der Operation verbundene Krankenhausaufenthalt. Daher geht Fabian davon aus, dass sich „der Markt für Implantate auf der Basis von Magnesium gut entwickeln wird, auch wenn er mit einem gewissen Risiko behaftet ist“.
Interessant sind solche Materialien auch für gefäßerweiternde Stents. Diese filigranen Metallteile, die unter Einsatz von Lasertechnik hergestellt werden, reizen nach einigen Wochen das Gewebe, das sie gerade noch gedehnt haben, und regen Zellwachstum an. So besteht das Risiko, dass sich das Gefäß möglicherweise wieder verschließt. Mit abbaubaren Stents aus Magnesium würde dieses Problem vermieden – so dass mit großen Stückzahlen gerechnet werden kann.
Ihr Stichwort
• Gelenkimplantate
• Tissue Engineering
• Oberflächenbeschichtungen
- Navigationssysteme
- Magnesiumbearbeitung
Unsere Whitepaper-Empfehlung
Gewährleisten Sie Sterilität bei Medizinprodukten, wie Implantaten und OP-Material. Das Whitepaper von BGS Beta-Gamma-Service gibt Einblicke in den Ablauf, Vorteile, Validierungsschritte der Strahlensterilisation & wichtige Aspekte beim Wechsel des Sterilisationsverfahrens. Jetzt…
Teilen: