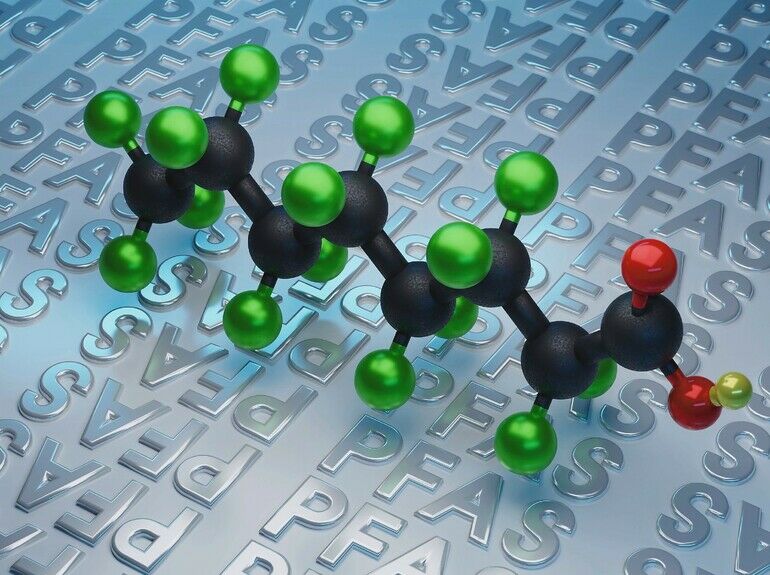Die einfache, sichere und intuitive Bedienung von IT-Geräten ist im Medizinumfeld längst noch keine Realität, Usability wird meist stiefmütterlich behandelt. Bei Medizinprodukten könnte sich dies ändern: Deren Entwicklung muss nun durch eine Gebrauchstauglichkeitsakte begleitet werden.
„Apple hat mit seinem Mobiltelefon iPhone gezeigt, wie sich das gesamte Industriedesign einer Produktkategorie alleine durch die intuitive Bedienung verändern kann. Eine solche selbsterklärende Bedienung ist auch bei IT-Geräten im medizinischen Umfeld keine Fiktion“, sagt Manfred Dorn, Director der Abteilung User Interface bei Phoenix Design GmbH + Co. KG in Stuttgart. Ärzte und Pflegekräfte können sich dies sehr wohl vorstellen: „Viele Anwender kommen auf uns zu und fordern: Ich möchte, dass die Bedienung dieses Geräts genau so einfach ist wie des iPhones“, bestätigt Matthias Meierhofer, Vorstandsvorsitzender der Münchner Meierhofer AG und Vorstandsmitglied des Verbands der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen (VhitG) e.V. mit Sitz in Berlin. Doch weiß er nur zu gut: „Technisch ist vieles machbar, doch sprechen die Rahmenbedingungen eine andere Sprache: Der deutsche Markt honoriert unsere Anstrengungen hinsichtlich solcher technologischer Fortschritte einfach nicht.“
Ein Mediziner benennt die Gründe: „Hippe Bedienelemente und Gimmicks reichen nicht. Letztlich geht es beim Thema Usabilty immer darum, dass der Anwender mit einem Gerät oder System seine Aufgabe gut erfüllen können muss“, sagt Dr. Rainer Röhrig, Anästhesist und Medizininformatiker an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er stellt klar: Anwender in der Medizin erwarten von der IT und medizintechnischen Geräten immer einen Nutzen – sei es hinsichtlich Datenqualität, Prozessqualität und der daraus resultierenden Patientensicherheit. „Usability heißt: Die richtige Information muss zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Prozessschritt zur Verfügung stehen. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, also die Benutzeroberfläche und Softwareergonomie, macht dabei nur einen kleinen Teil aus.“
Er nennt das Beispiel mobile Visite per Tablet-PC: Hier benötigt man für eine gute Usability neben ergonomischer Software und eventuell Multitouch-Fähigkeit eine Hardware, die sich wirklich tragen lässt und dabei nicht zu warm wird, sowie ein drahtloses Netzwerk in der Klinik, das gut ausgeleuchtet und so sicher ist, dass die Daten bei einem Ausfall nicht verloren gehen. Selbst Usability-Experte Alexander Steffen, Manager Medical Solutions bei der User Interface Design GmbH (UID), Ludwigsburg, räumt bei aller Anerkennung für Apple ein: „Das ideale Bedienkonzept für medizinische Geräte erlaubt in der Regel keine iPhone-Oberfläche.“
Trotz aller Herausforderungen sehen die Experten die Hersteller von IT-Equipment im medizinischen Umfeld in der Pflicht, eine gute Anwendbarkeit ihrer Systeme zu gewährleisten: „Eine massive Fehlerquelle liegt schließlich darin, dass ein Mitarbeiter aufgrund der Komplexität ablehnt, ein System zu nutzen, auf dessen Grundlage er eine Entscheidung fällen muss“, so Meierhofer. Phoenix-Design-Manager Dorn geht noch einen Schritt weiter und nennt Bedienfehler als eine häufige Ursache von Unfällen in der Medizin. „Die Folgen sind schwerwiegend: Im Extremfall kann die Gesundheit oder gar das Leben eines Menschen davon abhängen, wenn Apparate und Maschinen fehlbedient werden.“
Diese Einschätzung teilen Ärzte und Pflegepersonal, wie eine Studie unter der Leitung von Dr. Ulrich Matern, heute Geschäftsführer der wwH-c GmbH, Tübingen, zu Arbeitsbedingungen und Sicherheit am Arbeitsplatz Operationssaal (OP) belegt. 70 % der befragten 425 Chirurgen und die Hälfte der 190 befragten Pflegekräfte gab an, hin und wieder Schwierigkeiten bei der korrekten Bedienung von Geräten zu haben – und dass Probleme mit der Gerätebedienung in vielen Fällen zur Gefährdung der im OP befindlichen Personen geführt haben.
„Die Ergebnisse der Studie sind zwar ein paar Jahre alt, haben aber nichts von ihrer Aktualität eingebüßt“, ist sich Dorn sicher. UID-Experte Steffen pflichtet ihm bei: „Es besteht noch erheblicher Nachholbedarf in der Medizintechnik hinsichtlich der Usability. Einen zielgerichteten, nutzerzentrierten Gestaltungsprozess haben bislang die wenigsten Hersteller etabliert.“ Der aber ist ab dem 22. März 2010 notwendig: An diesem Tag endet die Übergangsfrist der Norm DIN EN 62366, dann dürfen Medizinprodukte nur noch mit einem Usability File auf den Markt gebracht werden. Neben der Durchführung eines vollständigen Usability-Entwicklungsprozesses fordert die Norm im Verbund mit der DIN EN 60601-1-6 auch eine konsequente, detaillierte Dokumentation aller Analyse- und Gestaltungsschritte in Form eines Usability File. Das Usability File umfasst alle Planungen, Entwürfe, Prototypen, Tests sowie deren Ergebnisse. „Diese Norm, die ebenso für die Usability von Verpackungen für Medizinprodukte gilt wie für Software zur Verabreichung von Medikamenten oder für die Diagnostik, verschärft das Medizinproduktegesetz noch einmal erheblich. Ziel ist es, mittels Tests sicherzustellen, dass der Endanwender bei der Ausübung der Hauptbedienfunktionen mit dem Produkt nichts falsch machen kann“, erklärt Steffen.
Um die Gebrauchstauglichkeit eines unter das Medizinproduktegesetz fallenden IT-Produkts sicherzustellen, empfiehlt Steffen den benutzerzentrierten Gestaltungsprozess einzuhalten, den die Norm DIN EN 13407 aufzeigt. Steffen: „Dies ist das Handwerkszeug von uns Usability-Experten.“ In ihm wird dem tatsächlichen Benutzer – sei es eine Pflegekraft, ein Chirurg oder ein Patient – eine aktive Rolle zugewiesen. „Weder der technikverliebte Softwareentwickler noch ein dem Unternehmen gewogener Professor sollen hier den Ausschlag geben, sondern der spätere Anwender“, sagt Steffen.
Der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess umfasst insgesamt vier Phasen:
- 1. Analyse von Kontext und Nutzung. Hier geht es darum, sich über den Kontext und die Nutzung der Hauptbedienfunktionen Klarheit zu verschaffen. Das heißt, man muss sich beim Endanwender vor Ort umsehen: Wer arbeitet mit dem Gerät oder der Software? In welcher Umgebung? Mit welcher Ausbildung? Bei welchen physikalischen Arbeitsbedingungen, ist es also hell oder dunkel, laut oder leise, wie lang sind die Schichten? In welchem Land soll das Gerät eingesetzt werden? „Viele Hersteller berücksichtigen nicht früh genug die Internationalisierbarkeit des Produkts“, erklärt Steffen und nennt ein Beispiel: So steht ein Gerät zur Grippevirenidentifizierung in Japan nur in Speziallabors, in den USA hingegen auf dem Schreibtisch eines Assistenten. Das Ziel: Je besser die Ausgangslage und alle Nutzungskontexte analysiert sind, desto besser und früher kann ein Hersteller die Anforderungen an ein Produkt erfüllen. Dorn: „Das ist weitaus kostengünstiger, als später im Entwicklungsprozess noch Änderungen vorzunehmen.“ Ein ansprechendes und durchdachtes grafisches Design erhöht die Übersichtlichkeit und visualisiert eine hohe Produktqualität. Der nutzerzentrierte Gestaltungsprozess verhindere zudem den großen Kardinalfehler, dass Interface Designer zu spät zur Entwicklung hinzugezogen werden: „Von ihnen wird in einer späten Entwicklungsphase verlangt, dass sie durch schöne Symbole und mit Farben das Produkt noch verbessern oder im schlimmsten Fall strukturelle Fehler korrigiert werden sollen. Doch dies ist eindeutig zu spät. Wenn Interface Designer, Usability Ingenieur, Programmierer und Produktverantwortlicher frühzeitig und konstruktiv zusammenarbeiten, entstehen effizient und schnell sehr nutzerfreundliche Lösungen.“
- 2. Dokumentieren von Anforderungen an das IT-System. Dabei sollten Standards und Normen einbezogen werden – und auch die so genannten Dialogprinzipien. Dazu gehören die Aufgabenangemessenheit, die Selbstbeschreibungsfähigkeit, die Lernförderlichkeit oder die Fehlertoleranz – wie kann der Nutzer eine falsche Eingabe rückgängig machen, ohne gleich wieder die gesamte Maske ausfüllen zu müssen.
- 3. Entwurf des Bedienkonzepts. Das Produkt wird erfahrbar – eine Simulation. Dorn empfiehlt hier eine gute Visualisierung. „Dabei spreche ich nicht von einer Konzeptvisualisierung, darunter können sich die Anwender nichts vorstellen. Man muss eine gestaltete Simulation mit den Kernfunktionen bauen, denn für den User spielt es sehr wohl eine Rolle, welche Größe, Farbe und Anmutung beispielsweise ein Button hat.“
- 4. Empirische Evaluation des Bedienkonzepts: Tests mit den richtigen Benutzergruppen müssen belegen, ob die Personen die Hauptbedienfunktionen problemlos betätigen können. „An dem Punkt geraten viele Unternehmen an Agenturen, die eigentlich Marktforschung betreiben und dem Kunden eine Marktstudie mit 100 Nutzern vorschlagen. Das ist teuer und nicht notwendig“, warnt Steffen. Seiner Erfahrung nach reichen für die Tests 14 bis 16 tatsächliche Anwender, wenn der Entwicklungsprozess nach der Norm nutzerzentriert abläuft. In den meisten Fällen reiche es dabei, die Teststudie im Labor durchzuführen. Dabei führt der Endanwender in einer Einzelsitzung Aufgaben nach Aufforderung durch einen Moderator aus – unter Beobachtung von Experten, die mit Kameras und Einwegspiegeln die Aktionen verfolgen. Der Moderator animiert den Probanden, dabei „laut“ zu denken und seine Handlung zu kommentieren. Die DIN EN 13407 will außerdem, dass für diese Tests Akzeptanzkriterien definiert werden – wie zum Beispiel: Acht von zehn Testern müssen die Aufgabe erledigen können, ohne im Manual nachzuschlagen. UID-Experte Steffen: „Werden diese nicht erfüllt, muss man zurück zu Schritt eins im benutzerzentrierten Gestaltungsprozess und sich fragen, warum es nicht funktioniert hat.“ Sind die Ergebnisse positiv, kann das Usabilty File fertig geschrieben werden – einschließlich der Benennung aller Fehler, die beim Gebrauch des Gesamtsystems noch auftreten könnten.
Steffen ist sich sicher, dass die neue Norm zur deutlichen Verbesserung der Usability von medizintechnischer IT führt. Röhrig ist skeptisch: „Die Normen zwingen die Hersteller nur dazu, Akten zu führen und zu dokumentieren, dass sie sich mit dem Thema Usability auseinander gesetzt haben. Sie besagen nichts darüber, dass das Produkt besser geworden ist.“ Außerdem sieht er durch die Normen Mehrkosten auf die Hersteller zukommen, die auf die Produkte aufgeschlagen werden.
Auch Dorn hat Zweifel: „Eine Norm ist sicherlich gut, reicht aber nie aus.“ Sie könne nur einen Minimalkonsens schaffen und den Herstellern To-Do-Listen an die Hand geben, so dass diese wissen, an was sie alles denken müssen. Dennoch müsse man jeden einzelnen Punkt noch mal individuell auf seine Relevanz für das Produkt untersuchen. „Bei einer Entwicklung stur nach der Norm bleiben viele sinnvolle Aspekte auf der Strecke.“
Sabine Koll Fachjournalistin in Böblingen
Eine teure Marktstudie ist nicht nötig, wenn der Nutzer von Beginn an im Fokus steht
Ihr Stichwort
- Usability
- Software-Ergonomie
- Usability File
- DIN EN 62366
- Benutzerzentrierter Gestaltungsprozess
Teilen: