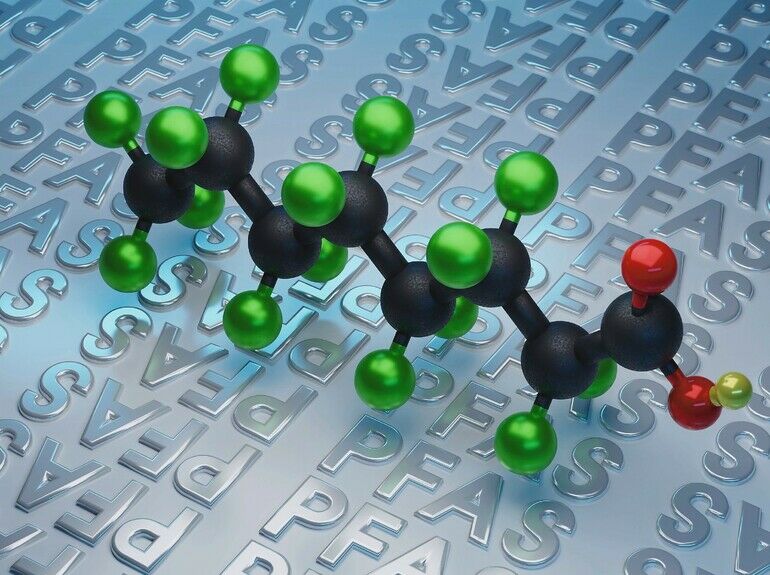Informationen zusammenfassen, ein Komplettbild vermitteln: Das sollten Geräte auf der Intensivstation leisten, um Ärzten und Pflegepersonal ihre Aufgabe zu erleichtern. Was veränderte Alarmfunktionen dazu tun können, erläutert Dr. Beate Buß.
Frau Dr. Buß, was verstehen Sie unter dem Alarmproblem in der Intensivmedizin?
Seit den 1970er-Jahren sind immer mehr Geräte für die Intensivmedizin entwickelt worden. Deren akustische Signale sollen Ärzte und Pflegepersonal auf kritische Ereignisse beim Patienten aufmerksam machen. Heute können aber am Bett eines einzigen Patienten durchaus mehr als 40 Alarme signalisiert werden– und das Personal deaktiviert diese, weil sie zum Teil nur noch als Lärm empfunden werden und auch das Befinden der Patienten beeinträchtigen.
Was macht den Alarm zum Lärmfaktor?
Die häufigen, falsch positiven Signale tragen viel dazu bei. Derzeit entwickeln viele ihre Geräte noch immer nach der Maxime ‚better safe than sorry‘, das heißt, wirklich jede eventuell kritische Situation führt zu einem akustischen oder visuellen Warnsignal. Wenn ein Beatmungsgerät ausfällt, ist das sicher gerechtfertigt. Wenn aber ein anderes Gerät mit der gleichen Dringlichkeit Alarm schlägt, weil gerade ein Messwert nicht richtig abgeleitet wird, ist das nicht angemessen und berücksichtigt den Arbeitskontext zu wenig. Ein weiterer Faktor ist, dass jedes Gerät für sich geplant wird und dann seine Meldungen gibt – statt Einzelwerte zu sinnvollen Meldungen zusammenzufassen.
Wie viele Alarme könnte eine Kraft auf der Intensivstation sinnvollerweise verwalten?
Eine genaue Zahl dafür zu nennen ist schwierig. In der Literatur wird oft von sieben Alarmen geschrieben, aber das hängt natürlich von der Erfahrung einer Person und ihrem Verständnis für die Situation ab. Wenn man verallgemeinern will, gilt: Je weniger Signale, desto besser.
Was könnten die Hersteller optimieren?
Existierende mathematische Algorithmen könnten dazu beitragen, die falsch positiven Signale zu reduzieren. Abgesehen davon befassen sich die Entwickler oft zu sehr mit ihrem Einzelgerät. So kann es sein, dass sich eine nicht akut lebenswichtige Ernährungspumpe bei Problemen mit einem schrillen und lauten Ton meldet, während die Spritzenpumpe akuten Handlungsbedarf wesentlich dezenter anmahnt. Hilfreich wäre es hier, das Umfeld genauer einzuschätzen und zu fragen, welche Signale Arzt und Pflegepersonal dort brauchen. Ansätze in dieser Richtung sind schon zu bemerken: Einige Hersteller bieten vernetzte Systemlösungen an, in denen die Werte verschiedener Geräte gesammelt und in einen Kontext gebracht werden. Erst wenn die Plausibilität geprüft ist, wird der Alarm ausgelöst. Diese Tendenz, Signale zu integrieren und zu zentralisieren, muss man sehr positiv bewerten. Wenn dieser Trend anhält, haben wir vielleicht in zehn Jahren kein Alarmproblem mehr.
Woran können sich Entwickler oder Ingenieure beim Gestalten der Alarme orientieren?
Für Medizinprodukte generell schreiben die IEC 60601-1-8 und die IEC 62366 vor, dass begleitend zur herkömmlichen Entwicklung auch Usability Engineering betrieben und entsprechend dokumentiert werden muss. Das bedeutet, es muss eine umfangreiche Nutzungskontextanalyse durchgeführt werden, und Gefährdungen, die aus der Benutzung des Gerätes erwachsen, geprüft werden. Die Verifizierung und Validierung der Designentwürfe nach Kriterien, die für die Gebrauchstauglichkeit relevant sind, ist unerlässlich und nachzuweisen. Die Norm IEC 60601-1-8 enthält speziell viele Vorgaben für die Gestaltung von Alarmen. Sie gibt einen Rahmen vor, der noch viel individuellen Spielraum lässt. Und manchmal hat man den Eindruck, dass Hersteller mehr Wert darauf legen, dass man ihr Gerät an der Melodie erkennt als dass es sich in ein Arbeitssystem voller verschiedener Klänge sinnvoll einfügt.
Gibt es vorbildliche Beispiele aus anderen Branchen, die das Problem gelöst haben?
Das Cockpit im Flugzeug wird in diesem Zusammenhang oft zitiert. Ich bin allerdings der Meinung, dass dieser Vergleich nicht glücklich ist, weil das Umfeld in der Medizin ganz anders ist. Die behandelten Patienten sind sehr heterogen und der Krankheitsverlauf oft nicht vorhersehbar. Eine Vielzahl unterschiedlicher, im Raum verteilter Geräte muss überwacht werden. Informationsüberflutung ist ein den Alltag bestimmender Faktor – um nur einige Aspekte zu nennen. Bei einer zunehmenden Vernetzung der medizinischen Geräte auf den Intensivstationen werden Erfahrungen aus der Leitwartenentwicklung, wie beispielsweise in Kraftwerken, interessanter.
Spielen solche Überlegungen bei Geräten für die Intensivstationen schon eine Rolle?
Vor allem in den USA und in Schweden laufen Projekte, die zeigen, wie eine vernetzte Intensivstation arbeiten könnte.Ein Spezialist, der weit entfernt ist, unterstützt das Personal vor Ort in kritischen Situationen. Damit so etwas funktioniert, müssen Alarme und Informationen zentralisiert werden. Diese Ansätze, die unter der Abkürzung eICU für electronic Intensive Care Unit bekannt sind, werden sicherlich auch einen massiven Einfluss auf das Alarmmanagement der Station haben.
Welche Perspektiven sehen Sie für Geräte mit Alarmfunktion?
Wenn wir es schaffen, die Technik vernetzt arbeiten zu lassen – und damit ist auch die herstellübergreifende Vernetzung gemeint–, können wir zukünftig zum Beispiel einen PDA einsetzen, um Arzt oder Pfleger dort zu warnen, wo sie sich gerade aufhalten. Sinnvoll wäre es vielleicht sogar, die Signale bestimmter Gerätetypen herstellerübergreifend zu standardisieren, um sie erkennbar zu machen. Eine Herausforderung neben dem intensivmedizinischen Arbeitsfeld werden Alarme für den Homecare-Bereich sein, die eine außenstehende Person zum Beispiel über den gefährlichen Sturz eines Patienten informieren, einen überflüssigen Eingriff in die Privatsphäre aber ausschließen.
Wo ist der Handlungsbedarf am größten?
Die wichtigste Frage, die der Entwickler beantworten muss, ist: Dient mein Gerät dem Anwender bei seiner Aufgabe? Wenn dieser anwenderzentrierte Ansatz forciert wird, ist schon viel erreicht.
Dr. Birgit Oppermann birgit.oppermann@konradin.de
Unsere Webinar-Empfehlung
Armprothesen und andere medizinische Hilfen mit dem 3D-Drucker individuell, schnell und kosteneffizient herstellen
Teilen: