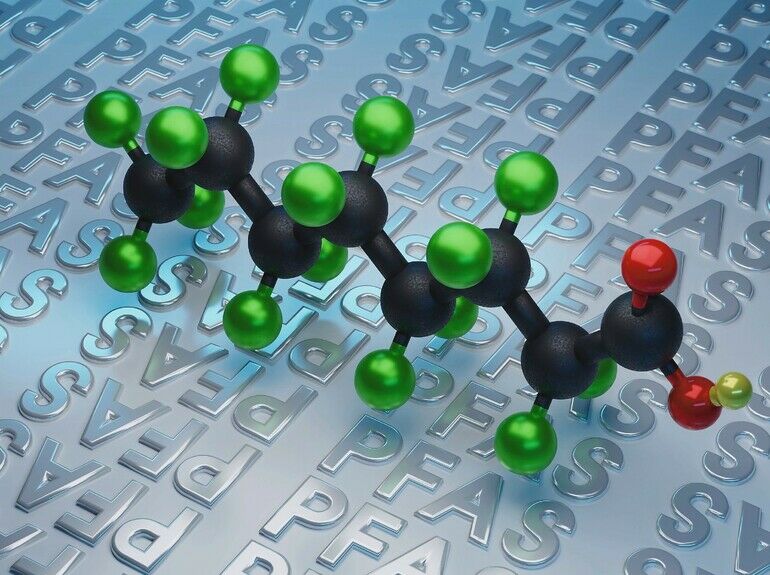Herzrhythmusstörungen | Noch ist die Rede von Grundlagenforschung. Aber Bonner Wissenschaftler haben grundsätzlich nachgewiesen, dass ihre Idee von einem optogenetischen Defibrillator funktioniert. Wie, das erläutert Prof. Philipp Sasse.
Dr. Birgit Oppermannbirgit.oppermann@konradin.de
Herr Professor Sasse, wie kamen Sie auf die Idee für einen implantierbaren Defibrillator, der das Herz mit Licht wieder in den richtigen Takt bringt?
Wir haben einige Jahre lang an einem System für die optogenetische Stimulation des Herzens gearbeitet und dabei an Zellkulturen beobachtet, dass ein längerer Lichtreiz auf die Zellen diese für geraume Zeit inaktiviert. So eine Inaktivierung ist bei Kammerflimmern erwünscht, um die Muskelzellen wieder in den richtigen Takt zu bringen. Die Beobachtung an den Zellkulturen führte uns zu der Frage, ob man diesen Effekt nicht auch für einen implantierbaren Defibrillator nutzen könnte. Inzwischen haben wir an Mäusen nachgewiesen, dass dieser Ansatz grundsätzlich funktioniert.
Welche Vorteile hätte dieser Ansatz gegenüber heute üblichen Geräten?
Wir sehen drei mögliche Vorteile. Elektrische Defibrillatoren wirken über einen starken elektrischen Reiz, der ausgelöst wird, sobald das Gerät eine Arrhythmie detektiert. So ein elektrischer Reiz betrifft aber nicht nur die schmerzunempfindlichen Herzmuskelzellen, sondern auch die Brustmuskeln und verschiedene Nervenenden drum herum – und das ist für den Patienten unangenehm. Dieser Schmerz ließe sich mit einem optogenetischen System vermeiden, denn zum einen brauchen wir den starken elektrischen Reiz nicht und zum anderen würde der im Körper ausgelöste Lichtreiz nur auf die genetisch entsprechend veränderten Herzmuskelzellen wirken. Der zweite Vorteil wäre, dass die Schädigungen am Gewebe, die man nach Stromstößen beobachtet hat, nicht auftreten. Den dritten Vorteil können wir noch nicht belegen, aber wir gehen davon aus, dass ein System nach dem von uns vorgeschlagenen Prinzip weniger Energie verbraucht und damit länger im Einsatz sein kann, bevor es operativ ausgetauscht werden muss.
Seit wann arbeiten Sie daran?
Das Prinzip der optogenetischen Stimulation wurde erstmals 2005 anhand von Nervenzellen gezeigt, –und die Idee mit dem Defibrillator verfolgen wir seit etwa vier Jahren.
Welche Erkenntnisse liegen schon vor?
Das Konzept funktioniert. Das haben wir in genetisch veränderten Mäusen nachgewiesen. Deren Herz hat natürlich eine andere Dimension als ein menschliches Herz. Aber in Zusammenarbeit mit Kollegen in Amerika haben wir auf der Basis von Simulationen an Patientendaten gesehen, dass der Lichtreiz auch in menschlichem Gewebe den gewünschten Effekt haben könnte. Allerdings ist es für Euphorie noch zu früh: Wir haben noch viele Jahre der Forschung vor uns, bevor man an ein konkretes Medizinprodukt denken könnte.
Welche Aufgaben liegen da vor Ihnen?
Es gibt technische und molekulargenetische Aspekte, die noch nicht gelöst sind. Die technischen sind möglicherweise die einfacheren: Da ist die Frage, wie ich im Körper das Licht erzeuge, das tief genug in die bis zu ein Zentimeter tiefe Herzwand eindringt, um alle Herzmuskelzellen zu inaktivieren und neu starten zu lassen. Da kommen Lichtleitergewebe oder Netze in Frage, oder organische LEDs, die es in ausreichender Größe und Flexibilität für den schlagenden Muskel geben müsste. Und diese müssten implantierbar sind. Heikler ist aber sicher die Frage der genetischen Veränderung. Damit die Herzmuskelzellen das lichtempfindliche Eiweiß herstellen und dann auf den Lichtreiz reagieren, muss man die entsprechenden Gene an den richtigen Ort bringen. Es gibt spezielle Viren, die heute schon in der Medizin eingesetzt werden und als sichere Systeme eingestuft sind. Ob und wie gut diese auch für unseren Fall geeignet sind, muss man untersuchen. Für uns wird aber der nächste Schritt sein, das Prinzip an größeren Tieren wie Kaninchen oder Schweinen zu testen. Von Therapieversuchen an Menschen sind wir noch acht bis zehn Jahre entfernt.
Wie sähe ein Defibrillator aus, der die Reize in Form von Licht überträgt?
Sehr ähnlich wie die heutigen Geräte. Man würde die optogenetische Variante sicherlich auch nicht allein vorsehen, sondern als zusätzliche Sicherheit den Elektroschock als Möglichkeit im Gerät erhalten. Es geht im Zweifelsfall ja um das Leben des Patienten: Wenn die schmerzfreie Therapie aus irgendwelchen Gründen versagt, soll die zwar schmerzhafte, aber Erfolg versprechende Elektroschock-Therapie auch verfügbar sein.
Was ist über eventuelle Risiken und Nebenwirkungen bekannt?
Semiflexible Lichtwellenleiter könnten ein mechanisches Risiko mit sich bringen, nämlich das einer Perforation. Das muss noch genauer untersucht werden. Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Immunreaktion des Körpers, die erfolgen könnte, wenn die Zellen nach der genetischen Veränderung ein körperfremdes Eiweiß herstellen. Auch darüber wissen wir noch zu wenig.
Unter welchen Bedingungen könnte diese Technik nicht eingesetzt werden?
Sie eignet sich nicht für den Notfalleinsatz, sondern nur für Patienten, die einen dauerhaft implantierten Defibrillator brauchen.
Welche Zusammenarbeit wünschen Sie sich mit Industrieunternehmen?
Mit den Herstellern von Lichtwellenleitern und Dioden sind wir schon in Kontakt. Uns wäre aber auch der Austausch mit den Herstellern implantierbarer Defibrillatoren sehr willkommen. Es wäre schön, wenn diese die Entwicklung des Projektes beobachten und begleiten würden. Daraus könnte sich ja eine Verbesserung der heutigen Produkte ergeben.
Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungen ein?
In fünf bis zehn Jahren werden wir sagen können, ob das Prinzip auch in größeren Herzen so funktioniert, wie es die Simulationsdaten nahelegen. Bis dahin wissen wir auch Genaueres dazu, wie ein Gentransfer verlaufen kann. Um schon jetzt Patientenerwartungen zu wecken, ist es also definitiv zu früh. Dennoch zweifeln wir nicht daran, dass das Prinzip Potenzial hat.
Wissenschaftliche Publikation: Bruegmann T et al. J. Clin. Invest. 2016 doi: 10.1172/JCI88950
Unsere Webinar-Empfehlung
Armprothesen und andere medizinische Hilfen mit dem 3D-Drucker individuell, schnell und kosteneffizient herstellen
Teilen: